Ihr Ansprechpartner in allen Fragen rund um das Verfassungsrecht:
Rechtsanwalt Christian Thome
thome@nonnenmacher.de
0721 / 985 22-18
Mandanten fragen uns häufig, ob es bei Vorliegen einer letztinstanzlichen Gerichtsentscheidung sinnvoll ist, noch eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht zu erheben. Viele machen von dieser Möglichkeit Gebrauch. Im Jahr 2022 verzeichnete das Bundesverfassungsgericht zwar einen im Vorjahresvergleich leichten Rückgang der neu eingehenden Verfahren. Im Verfahrensregister wurden aber immer noch knapp 5.000 Neueingänge erfasst. Mit einem unverändert hohen Anteil von 95 % stellen die Verfassungsbeschwerden weiterhin den größten Teil dieser Neueingänge dar, wie sich dem aktuellen Jahresbericht des Bundesverfassungsgerichts für das Jahr 2022 auf S. 48 entnehmen lässt.
Auf den ersten Blick erscheint der „Gang nach Karlsruhe“ ohne großes Risiko, weil gemäß Art. 93 Abs. 1 Nr. 4a Grundgesetz „jedermann“ – d.h. ohne anwaltliche Vertretung – eine Verfassungsbeschwerde erheben kann und hierfür auch keine Gerichtskosten anfallen.
Dauer und Erfolgsaussichten von Verfassungsbeschwerden
Die anfängliche Überzeugung wird jedoch mit einem Blick auf die Dauer und die Erfolgsaussichten von Verfassungsbeschwerden schnell getrübt. Für das Bundesverfassungsgericht gibt es zudem keine gesetzlichen Vorgaben über die Dauer der Verfahren oder deren Priorisierung bei der Bearbeitung. Auch die hohen rechtlichen Hürden trüben die anfängliche Euphorie: Verfassungsbeschwerden bedürfen der Annahme zur Entscheidung (§ 93a Bundesverfassungsgerichtsgesetz - BVerfGG). In den allermeisten Fällen entscheidet hierüber eine Kammer (bestehend aus drei Richtern). Die Beschwerde wird nach § 93a Abs. 2 BVerfGG nur dann zur Entscheidung angenommen, wenn ihr grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung zukommt oder, wenn es zur Durchsetzung der in § 90 Abs. 1 genannten Rechte angezeigt ist. In der Praxis führt dies in der weit überwiegenden Anzahl der Fälle zu einer Ablehnung der Verfassungsbeschwerde durch einen Nichtannahmebeschluss.
Ursachen für die lange Verfahrensdauer und niedrige Erfolgsaussichten
Diese – auf den ersten Blick sehr ernüchternden – Umstände haben insbesondere folgende Ursachen:
Die hohen Zulässigkeitsvoraussetzungen einer Verfassungsbeschwerde
Das Bundesverfassungsgericht entscheidet über Verfassungsbeschwerden, die von jedermann mit der Behauptung erhoben werden können, durch die öffentliche Gewalt in einem seiner Grundrechte oder in einem seiner in Artikel 20 Abs. 4, 33, 38, 101, 103 und 104 Grundgesetz enthaltenen Rechte verletzt zu sein. In aller Regel wenden sich Bürger gegen Gerichtsentscheidungen. In der Praxis gibt es hier sehr viele Fälle, in denen (häufig vorschnell) eine Verfassungsbeschwerde erhoben wird. Dies führt zu einer hohen Auslastung des Bundesverfassungsgerichts und zu einer langen Verfahrensdauer. Es kommen hohe Zulässigkeitsvoraussetzungen hinzu:
Die Kombination aus dem weiten Feld der möglichen Grundrechtseingriffe, dem eingeschränkten Prüfungsumfang des Bundesverfassungsgerichts verbunden mit hohen Zulässigkeitsvoraussetzungen führt in der Praxis einerseits zu der hohen Auslastung (und Verfahrensdauer) und andererseits zu statistisch niedrigen Erfolgsaussichten.
Insbesondere: Form, Frist und Begründung der Verfassungsbeschwerde
Praxisrelevant sind vor allem folgende Punkte, die von Beschwerdeführern unbedingt berücksichtigt werden sollten. Denn die hohen formellen Anforderungen führen häufig zu einer Nichtannahme der Verfassungsbeschwerde.
Form
Verfassungsbeschwerden sind schriftlich beim Bundesverfassungsgericht einzureichen und zu begründen (§ 23 Abs. 1 BVerfGG). Die Begründung muss umfangreiche Angaben und regelmäßig Anlagen enthalten, da diese die Grundlage einer Entscheidung bildet (vgl. § 92 BVerfGG).
Frist
Die Verfassungsbeschwerde gegen Entscheidungen der Gerichte und Behörden ist nur innerhalb eines Monats zulässig (§ 93 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG). Auch die vollständige Begründung muss innerhalb dieser Frist eingereicht werden (§ 93 Abs. 1 Satz 1 BVerfGG). Die Begründung kann nicht nach Fristablauf nachgereicht werden. Eine Verlängerung der Frist durch das Gericht ist ebenfalls ausgeschlossen. Die Frist beginnt grundsätzlich mit der Zustellung oder formlosen Mitteilung der in vollständiger Form abgefassten Entscheidung.
Begründung
Die Begründung ist das Herzstück einer erfolgreichen Verfassungsbeschwerde, weil diese die Grundlage der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist. Diese muss daher unbedingt fristgerecht, ausführlich und präzise gestaltet werden. Zudem sind die für die Beurteilung der Erfolgsaussichten erforderlichen Unterlagen beizufügen. Folgender Praxistipp ist wichtig: Eine den Anforderungen entsprechende Begründung einer Verfassungsbeschwerde gegen fachgerichtliche Entscheidungen setzt voraus, dass der die Rechtsverletzung enthaltende Vorgang „substantiiert und schlüssig“ vorgetragen wird (BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 16. Oktober 2023 – 2 BvR 1330/23 –, juris Rn. 22):
Diesen sehr hohen Anforderungen gerecht zu werden, ist im Hinblick auf die Monatsfrist selbst für einen erfahrenen Rechtsanwalt häufig eine große Herausforderung, die viel Aufwand erfordert. Die praktische Erfahrung bei der Erhebung von Verfassungsbeschwerden kann hier nur von Vorteil sein. Viele Verfassungsbeschwerden scheitern, weil hier nicht gut genug gearbeitet wird. Dies zeigt die auf der Homepage des Bundesverfassungsgerichts vorhandene Entscheidungsdatenbank anschaulich. Durch eine umfassende und überzeugende Begründung der Verfassungsbeschwerde können die Erfolgsaussichten einer Verfassungsbeschwerde jedenfalls erhöht werden. Eine „Erfolgsgarantie“ gibt es natürlich auch in diesem Fall nicht.
Was es im praktischen Vorgehen zu beachten gibt
Die oben genannten Probleme können häufig durch eine qualifizierte Beratung durch einen Rechtsanwalt gelöst werden. Hierbei muss zunächst im Einzelfall realistisch abgewogen und besprochen werden, ob eine Verfassungsbeschwerde eine sinnvolle Möglichkeit ist und im Einzelfall Aussicht auf Erfolg haben kann.
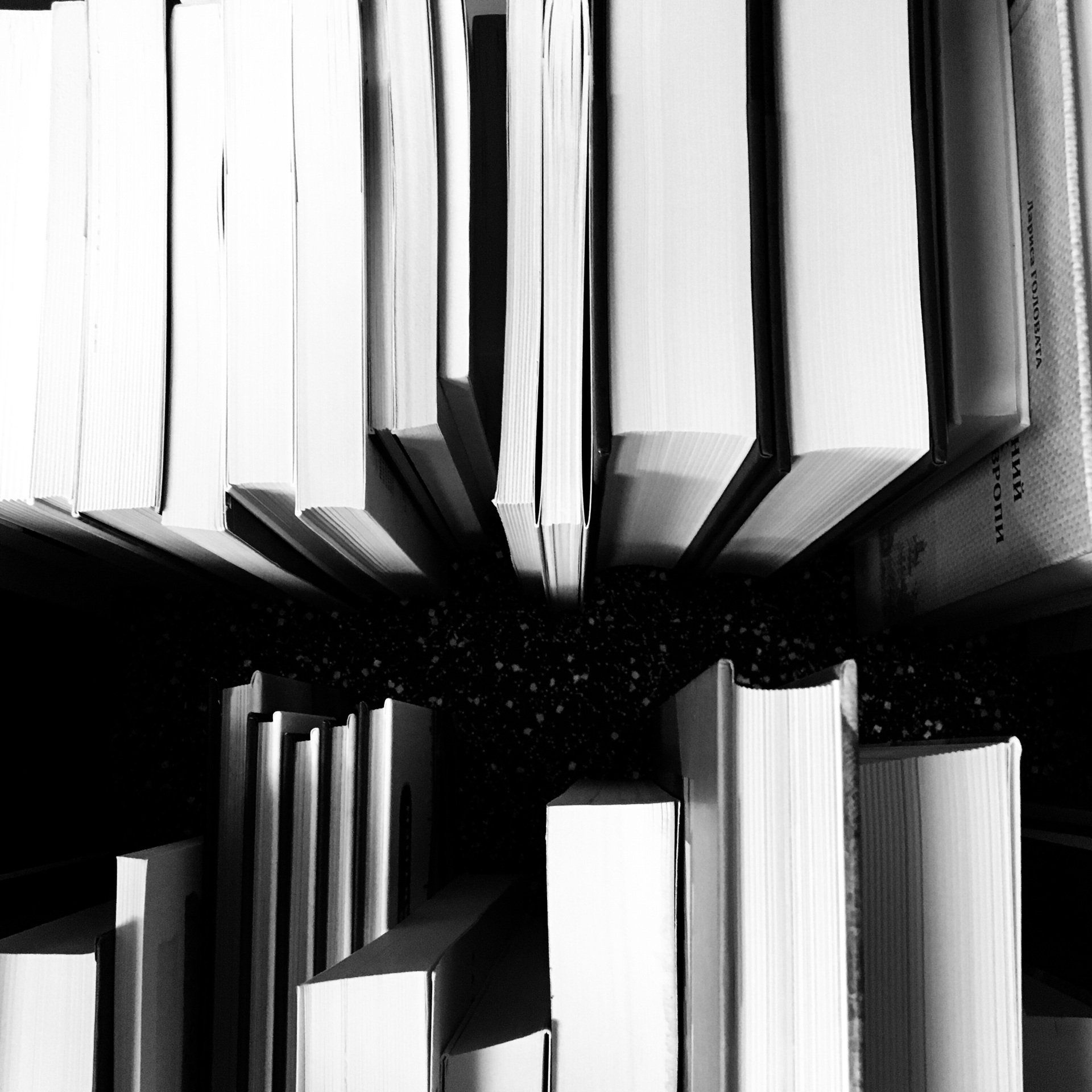
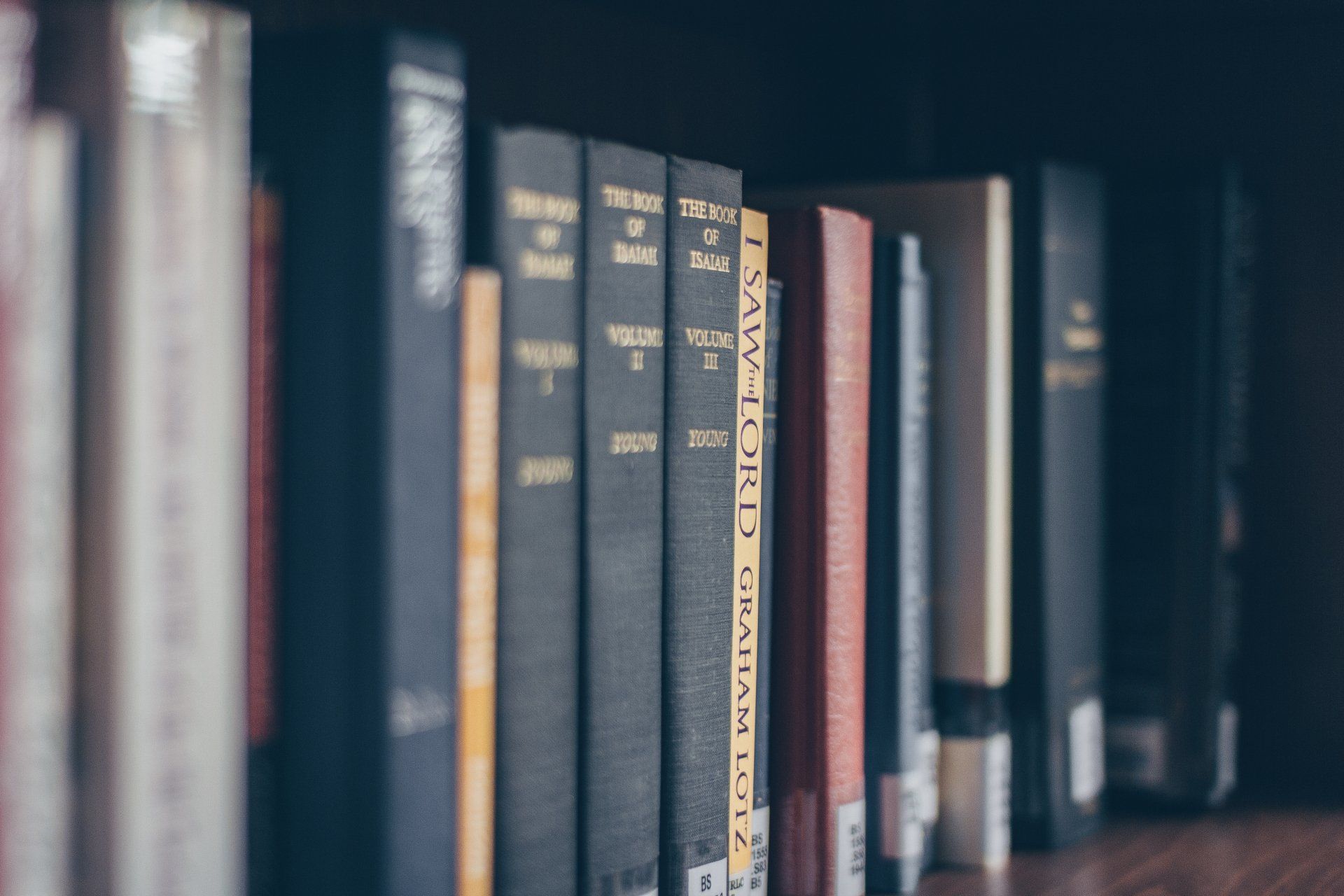

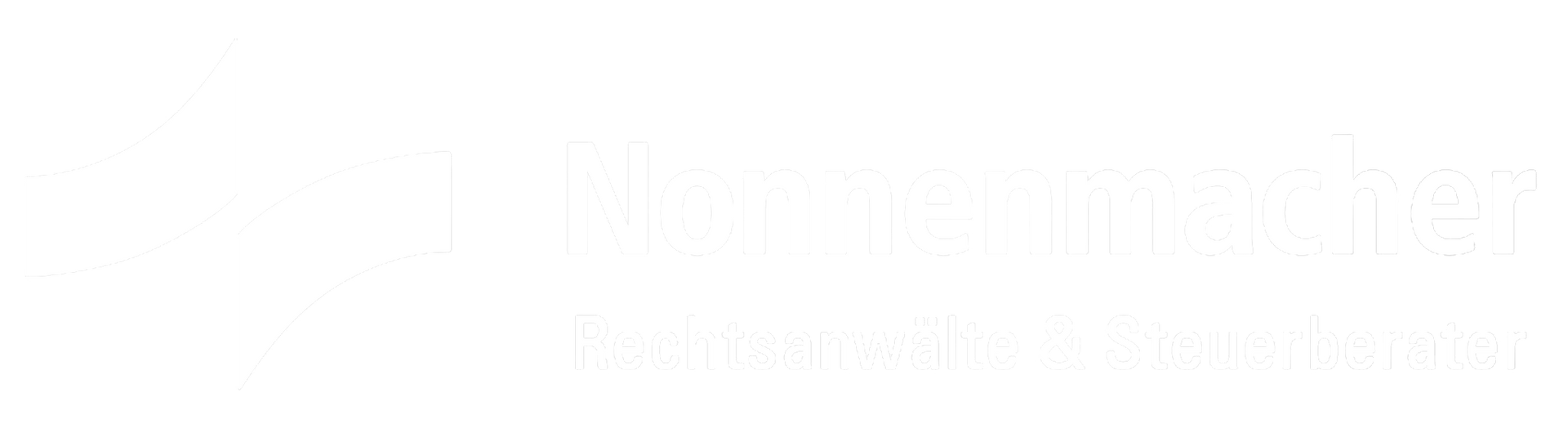
Nonnenmacher Rechtsanwälte Part mbB
Wendtstr. 17
76185 Karlsruhe
Tel.: 0721-985220
Fax: 0721-9852250
E-Mail:
rechtsanwaelte@nonnenmacher.de